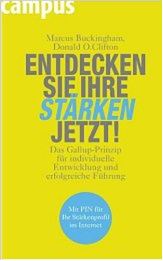
Buckingham, Marcus / Clifton, Donald O.,
Entdecken sie ihre Stärken jetzt
Frankfurt a.M.: Campus 3. Auflage 2007, 27€
4 von 5 Punkten
Nach meiner Meinung gibt uns Gott natürliche Begabungen und geistliche Begabungen. Er erschuf unsere Persönlichkeit. Das alles gilt es als Gesamtpaket zu entdecken. Dafür kann dieses säkulare Buch eine Hilfe sein. Dabei klingt vieles sehr logisch, muss aber mit der Lebenspraxis abgeglichen werden. Das Buch lässt natürlich auch den Gedanken der geistlichen, übernatürlichen Begabung außen vor.
Dieses Buch soll dabei helfen, seine Stärken zu entdecken. Zum Buch gehört ein detaillierter Online-Test, der auf Millionen geführter Interviews und Erkenntnisse das Gallup Institutes basiert, genannt StrengthsFinder (SF). Es gliedert sich in drei Hauptteile mit insgesamt 7 Unterkapiteln: 1. Die Anatomie einer Stärke (Starke Leben/Stärken stärken) 2. Entdecken Sie den Ursprung ihrer Stärken (Der StrengthsFinder/Die 34 Talent-Leitmotive des SF) / 3. Stärken umsetzen (Fragen, die sie beschäftigen/Stärken managen/Aufbau eines Unternehmens, das auf Stärken basiert) + Anhang mit Fachbericht über den SF.
Es geht von der Erkenntnis aus, „dass sich Menschen in ihrem Kern weniger verändern lassen, als wir glauben und verschwenden keine Zeit in dem Versucht, etwas herauszuholen, was die Natur in ihnen nicht vorgesehen hat. Stattdessen erkennen sie, was bereits vorhanden ist und holen das hervor.“ (:12). Es weist auch daraufhin, … „wie das Arbeits- und Aufgabengebiet möglichst auf den zu führenden Menschen und seine Stärken ausgerichtet werden sollte, statt zu versuchen den Menschen in fest definierte Stellenbeschreibungen pressen zu wollen.“ (:12). Unternehmen muss lt. dem Buch klar werden, dass die unterschiedlichen Talente der Menschen als Stärken genutzt werden müssen und die gesamte Organisation um die Stärken jeder einzelnen Person herum aufgebaut wird (:16). Die Thesen lauten: „1. Die Talente jedes einzelnen Menschen sind dauerhaft und einzigartig. 2. Der größte Spielraum liegt bei jedem einzelnen Menschen in den Bereichen ihrer oder seiner größten Stärken.“ (:20). Aus über zwei Millionen Interviews wurden daher 34 Talent-Leitmotive erarbeitet. Durch den Test erfährt jeder seine fünf dominierenden Talent-Leitmotive. Wer sie vergeudet, hat „Sonnenuhren im Schatten“ (lt. B. Fanklin:23).
Im 1. Hauptteil in Kapitel 1 „Starke Leben“ erhält man den Rat: „Schauen Sie in Ihr Inneres, versuchen Sie, Ihre stärksten Charakterzüge zu erkennen, verstärken Sie sie durch die Anwendung in der Praxis und stetiges Lernen, und finden Sie dann eine Aufgabe oder, wie er (Anm. Warren Buffet) es tat, arbeiten Sie für sich eine Aufgabe heraus, die diese Stärken jeden Tag nutzt.“ (:30). Stärke wird wie folgt definiert und erklärt (:33f): „Es ist die beständige, beinahe perfekte Leistung in einer Tätigkeit.“ Folglich: „Zunächst müssen Sie, damit eine Tätigkeit eine Stärke sein kann, in der Lage sein, sie beständig zu leisten. Und dies bedeutet, dass dies ein berechenbarer Teil ihre Leistung ist … Und sie müssen aus dieser Tätigkeit auch eine gewisse innere Befriedigung erlangen … Zweitens brauchen Sie nicht in jedem Aspekt ihrer Rolle eine Stärke aufweisen, um sie ausgezeichnet zu tun … Drittens werden Sie sich nur durch die Maximierung Ihrer Stärken hervortun, niemals durch das Fixieren auf Ihre Schwächen.“ Es gilt Wege zu finden, die Schwächen zu umschiffen, um frei zu werden, die Stärken zu stärken. Bei Schwächen muss man Schadensbegrenzung machen, Stärken müssen genutzt werden. Um das zu leisten, schlagen die Autoren drei „revolutionäre Werkzeuge“ vor (:35f).
Es gilt 1. „… zu verstehen, wie Sie Ihre natürlichen Talente von den Dingen unterscheiden, die Sie lernen können … Die Frage ist nicht, ob Sie sich in diesen Tätigkeiten verbessern können oder nicht. Natürlich können sie es … Die Frage ist, ob Sie beständige, beinahe perfekte Leistungen in diesen Tätigkeiten allein durch die Praxis erreichen können … Um eine Stärke in irgendeiner Tätigkeit auszubilden, sind spezielle natürliche Talente erforderlich.“ Demnach sind Talent also natürliche wiederkehrende Denk-, Gefühls- oder Verhaltensmuster. Wissen besteht aus Erlerntem. Können und Fertigkeiten sind Schritte einer Tätigkeit (vgl.:37). „Diese drei Aspekte, Talente, Wissen und Können, ergeben Ihre Stärken.“ Um diese Stärken aufzubauen, gibt es angebrochenes Talent mit Können und Wissen zu vervollkommnen (:37). Dabei sind „… von diesen drei >Rohmaterialien< die Talente die wichtigsten. Ihre Talente sind angeboren …, während Können und Wissen durch Lernen und Praxisanwendung erworben werden können.“ (:37). „Obwohl es gelegentlich möglich ist, eine Stärke aufzubauen, ohne das erforderliche Wissen und Können zu erwerben, ist es niemals möglich, eine Stärke ohne das erforderliche Talent zu besitzen … Deshalb ist der Schlüssel zum Aufbau einer echten Stärke, Ihre dominierenden Talente zu erkennen und sie dann mit Wissen und Können zu verfeinern.“ (:38).
Das 2. Werkzeug (ab 39f) ist „… ein System zur Erkennung Ihrer dominierenden Talente“. Das ist der SF. Das 3. Werkzeug (ab 40f) ist eine „… gemeinsame Sprache zur Beschreibung Ihrer Talente.“ Lt. Verfasser, eine rudimentäre Angelegenheit. Daher kommen sie auf 34 beschreibende Talent-Leitmotive.
In Kapitel 2 „Stärken stärken“ geht es zunächst um Wissen und Können. Dabei wird zwischen sachlichem Wissen und Erfahrung unterschieden. „Können verleiht dem Wissen, das auf Erfahrung beruht, Struktur.“ (:50). Als Talent wird dann bezeichnet, was als nachhaltiges Denk-, Gefühls- oder Verhaltensmuster mit Wissen und Können kombiniert wird, um produktiv eingesetzt zu werden. Die Talente werden vom Gehirn erschaffen und sind daher dauerhaft. Das wird von 55-62 ausführlich und nachvollziehbar erklärt. „Fertigkeiten bestimmen, ob Sie etwas tun können, während Talente etwas viel Wichtigeres offenbaren: wie gut und wie oft Sie es tun.“ (:63). Ohne Talent kann man zwar trainieren, aber das entzieht Energie und ist immer nur Schadensbegrenzung, nicht Entwicklung. Die Autoren raten daher: „Erkennen Sie Ihre stärksten Talente, verfeinern Sie sie mit Können und Wissen, und Sie befinden sich auf dem besten Wege, ein starkes Leben zu führen.“ (:67).
Jetzt folgt der 2. Hauptteil mit der Erklärung zum SF. „Spontane Reaktionen, Sehnsüchte, schnelles Lernen und Befriedigungen werden Ihnen helfen, die Spuren Ihrer Talente zu entdecken.“ (:80). „Ein Talent für sich alleine ist weder gut noch schlecht. Es ist einfach ein nachhaltiges Muster, das entweder zu einer Stärke kultiviert oder außer Acht gelassen werden kann.“ (:84).
Dann werden in Kapitel 4 die 34 Talent-Leitmotive vorgestellt, immer auch mit Beispielen von realen Personen. Solche Talente sind z.B. Analytisch, Autorität, Höchstleistung, Fokus, Gerechtigkeit, Leistungsorientierung, Arrangeur, Vorstellungskraft, Wiederherstellung … klingt alles „exotisch“, wird aber ausführlich erklärt.
In Kapitel 5 (143-186) geht es dann um Fragen/Themen, die durch den Test aufgeworfen wurden: Hindernisse, um Stärken zu stärken (wider den falschen Ansatz: Schwächen, nicht Stärken verdienen die meiste Aufmerksamkeit) / Angst vor Schwächen (wider Schwächenorientierung) / Angst vor Versagen (pro Verantwortung für Talente aufzugreifen und dadurch Stärken auszubauen, durch Praxis und Lernen: „handeln, lernen, verfeinern, handeln, lernen, verfeinern“ (:150) Essenz der Stärke) / Angst vor dem eigenen Ich / Warum auf Stärken konzentrieren (ab 153f) / Reihenfolge der Talente / Fragen zur Talentbeschreibung / Unterschied zu anderen Menschen mit meinen Talenten (hier: auf die Kombination der Talente achten und sie kombiniert nutzen:159) / Sind manche Talente Gegensätze? / Kann man neue Talente entwickeln? / Besteht die Gefahr der Einseitigkeit? (hier meine Kritik: sehr hochtrabend formuliert auf 165, dass man mit den Talenten das Leben lebt, was man leben sollte) / Umgehen von Schwächen (dazu gibt es 5 Tipps: Werden sie etwas besser in ihrer Schwäche; Entwickeln sie ein Hilfssystem; Setzen sie eines ihrer stärksten Talente ein, um eine Schwäche zu überwinden; Finden sie einen Partner; Hören sie einfach damit auf) / Habe ich den richtigen Beruf ergriffen? (Berufsfeld und Rolle/Funktion).
Kapitel 6 (ab 187) beschäftigt sich mit dem Managen der Stärken. Die jeweiligen Talent-Leitmotive werden jetzt auf die Mitarbeiterführung angewendet.
Dann folgen in Kapitel 7 (ab 223) Tipps zum Aufbau eines Unternehmens, das auf Stärken basiert. Dabei geht es darum, die Gesamtorganisation um die Stärken jedes einzelnen Mitarbeiters herum aufzubauen (:226). Warum man das tun sollte, wird auf 226f erklärt. Dabei gilt es die Stärken herauszufinden, mit einem guten Auswahlsystem (228-249f). Hinzu kommt ein auf die Stärken basierendes System der Karriereförderung (249f). Hier interessant: „Unser großer Irrtum ist zu denken, dass alle menschlichen Wesen dieselbe Art von Prestige anstreben, das Prestige, das in der Macht liegt … Es sollten verschiedene Arten von Prestige verfügbar sein, um die unterschiedlichen sehr guten Leistungen widerzuspiegeln, die das Unternehmen anerkennen möchte …“ (252f). Dazu gehört es verschiedene Leitern zu bauen und auch die Titelstruktur zu ändern.
Ein Fachbericht über den SF rundet das Buch ab.
Hat man das gelesen, ist man erstmal beschäftigt, weil man viel über sich selbst und über das Denken von Unternehmen gelernt hat. Ich habe das Buch für ein Jahr zur Seite gelegt und bin es dann noch mal durchgegangen. Vieles, was vorgeschlagen wird, muss in der Praxis einer Organisation regelrecht inkulturiert werden.
Die eigenen Talente gilt es zu erkennen und sich selbst Wissen zu erwerben und Praxisraum zu schaffen, um die Talente zu leben. Das ist ebenfalls nicht so einfach, aber machbar. Alles in allem ein sehr anregendes Buch.

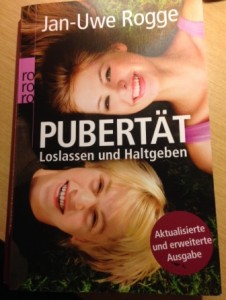 Rogge, Jan-Uwe
Rogge, Jan-Uwe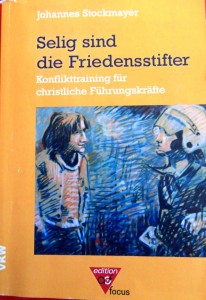 Stockmayer, Johannes, Selig sind die Friedensstifter – Konflikttraining für christliche Führungskräfte
Stockmayer, Johannes, Selig sind die Friedensstifter – Konflikttraining für christliche Führungskräfte Grün, Anselm, Lebensmitte als geistliche Aufgabe, Münsterschwarzach: Vier-Türme-Verlag 172008
Grün, Anselm, Lebensmitte als geistliche Aufgabe, Münsterschwarzach: Vier-Türme-Verlag 172008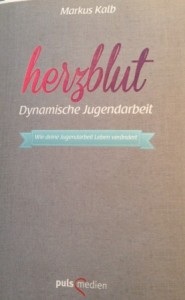 herzblut
herzblut