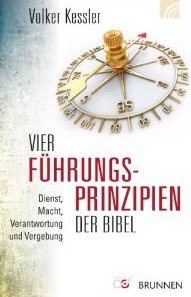 Kessler, Volker, Vier Führungsprinzipien der Bibel – Dienst, Macht, Verantwortung, Vergebung, Gießen/Basel: Brunnen Verlag 2012
Kessler, Volker, Vier Führungsprinzipien der Bibel – Dienst, Macht, Verantwortung, Vergebung, Gießen/Basel: Brunnen Verlag 2012
4 von 5 Punkten / 89 Seiten / € 9,99
Ein kleines, kompaktes und sehr feines Buch über Leitung. Volker Kessler, Leiter der Akademie christlicher Führungskräfte, schreibt ein Kompendium über Führung und erläutert die vier biblischen Führungsprinzipien: Dienst, Macht, Verantwortung und Vergebung. Dabei geht es Kessler mehr um den Charakter der Führungsperson, als um praktische Handlungsanweisungen.
Das Buch ist in sechs Kapitel unterteilt.
Das 1. Kapitel: Führen als Christ: Das Doppelgebot der Liebe, dient als Einleitung und legt die Grundlage. Das Doppelgebot aus dem Markusevangelium, Kapitel 12, Verse 29-31, gilt für alle Menschen und für Führungskräfte „… ganz besonders, weil Führungskräfte immer auch Vorbildfunktion haben.“ (:7) Ein Führer ist für Kessler jemand, dem anderen folgen, egal ob er viel oder wenig formale Macht hat oder ob er Lehrer, Redner oder Autor mit >geistiger Macht< ist. Unter einer christlichen Führungskraft versteht Kessler jemanden, der Christus bewusst nachfolgt, egal wo er führt. Aber: „Nur der sollte Menschen führen, der sie auch liebt.“ (:8) Dabei gilt die Regel, die Benedikt von Nursia für den Abt aufstellte: „Er hasse die Fehler, er liebe den Täter.“ (:8) Diese Liebe kommt aus der Tatsache, dass Christus uns zuerst geliebt hat. Von dieser Liebe her gilt es nun dienend, mit weisem Machteinsatz, verantwortlich und aus der Vergebung heraus Menschen zu führen.
Das 2. Kapitel: Führen als Dienst, beginnt Kessler mit dem Satz: „Dienende Führung ist das Leitbild christlicher Führung überhaupt.“ (:13) Er verweist auf die Aussage Jesu in Markus 10,42-25. Damit wird die Hierarchie-Pyramide auf den Kopf gestellt. Es müssen aber lt. Kessler erst drei Missverständnisse geklärt werden: „die anderen dienen, ich führe“ / „ich diene und lasse die anderen führen“ / „ich diene und mache alles für andere“. Dienende Führung ist ein Paradoxon. Ein Führer will dienen und möchte, dass die zu führenden Menschen in ihrer Persönlichkeit wachsen. Deshalb möchte eine Führungskraft „… einem Ziel, einer Aufgabe, einer Organisation dienen. Dieser Dienst führt sie zu der Erkenntnis, dass es für die gemeinsame Aufgabe gut ist, wenn sie Verantwortung in der Leitung übernimmt.“ (:20) Kessler verweist hier auf die biblische Gabe der kybernesis (Steuerung – 1Kor 12,28). Sie hilft anderen Gabenträgern ihre Gaben einzusetzen. „Ein Leiter, der in erster Linie Diener ist, ist das Gegenteil von jemandem, der in erster Linie leiten will.“ (:20) Deshalb nehmen dienende Führungskräfte ihr Ego zurück, um andere in den Mittelpunkt zu stellen. „Für dienende Leiter steht der Dienst, der Auftrag im Vordergrund, nicht ihre Position.“ (:22). Dazu gehören die Annahme der Menschen und das Führen in die Selbstverantwortung. Folglich folgen die Menschen freiwillig, weil der Führer eine personale Autorität hat. Wichtig ist die Fähigkeit sich selbst zu führen, Kritik einordnen zu können und gut zuzuhören. Er schließt u.a. mit den Sätzen: „Eine gute christliche Führungskraft dient erstens Gott, zweitens ihrer Organisation und drittens den Menschen innerhalb dieser Organisation. Im Normalfall passen diese drei Dienste zusammen. Im Konfliktfall ist allerdings eine Führungskraft zuerst Gott gegenüber verpflichtet, dann dem Auftrag, zu dem sie berufen wurden, und dann den Mitarbeitern, die ihr helfen sollen, diesen Auftrag zu erfüllen.“ (:27)
In Kapitel 3: Führen mit Macht, stellt Kessler zunächst klar: „Führen ohne Macht geht gar nicht.“ (:29). Er zeigt verschiedene Definition von Macht aus (u.a.“Macht ist Durchsetzungsmöglichkeit“). Aus theologischer Sicht wird Macht von Gott an die Menschen verliehen und beinhaltet daher Verantwortung gegenüber dem Geber der Macht. Vollmacht und Macht gehören für ihn zusammen. Macht kann missbraucht werden und es kann auf Macht verzichtet werden, was ebenfalls unmoralisch sein kann (Machtvakuum). „Ohne Macht kann ich meinem Nächsten gar nicht helfen.“ (:36) „Macht darf niemals Ziel an sich sein, sondern immer nur Mittel.“ (:36) „Ein Machteinsatz ist dann legitim, wenn er entweder Gutes bewirkt oder Böses verhindert.“ (:37) Informelle Macht ist riskant, weil sie nicht verantwortet werden muss. Weiter macht Kessler deutlich, dass Macht ein sozialer Prozess ist. Führung und Unterordnung wird zugelassen. Er zeigt ausführlich die verschiedenen Machtbasen auf (Macht durch Legitimation, Sanktionsmacht, durch Information, durch Identifikation) und sieht einen Trend weg von der hierarchisch organisierten Macht, hin zur personalen Macht (Wissen, Vertrauen, Charisma). Er geht weiter auf die interkulturelle Sicht von Macht ein, weil der Gebrauch von Macht in erster Linie von der jeweiligen Kultur abhängt. Schließlich stellt er sechs ethische Leitlinien zum Umgang mit Macht auf.
Kessler geht in Kapitel 4: Verantwortlich führen, auf die Verantwortung eines Leiters ein. Da ist zunächst die Verantwortung vor jemanden. „Eben weil sich der Mächtige verantworten muss, wird sein Machtgebrauch zum Dienst.“ (:53) Im biblischen Sinne geht es um eine doppelte Verantwortung: „Man ist vor jemandem verantwortlich, um man ist für etwas verantwortlich.“ (:54) Kessler verweist an dieser Stelle auf die Präambel des deutschen Grundgesetzes „vor Gott und den Menschen“. Für diese Verantwortung braucht es aber ein Bewusstsein. „Wer das Wesen der Verantwortlichkeit verstanden hat, der hat das Wesen des Menschen verstanden.“ (:58) Damit ist der Mensch auch immer für die Konsequenzen seiner Entscheidungen verantwortlich. Kessler geht weiter auf das Problem der Reichweite der Verantwortlichkeit ein. „Die Herausforderung der modernen Welt liegt darin, die Grenzen der eigenen Verantwortung zu definieren.“ (:61) Hier ist es für ihn entscheidend zuerst „seinen Nächsten“ im Blick zu haben.
Schließlich lebt ein Leiter aus der Vergebung heraus, was im Kapitel 5: Führen aus und mit Vergebung, deutlich wird. „Das Leben als Christ ist geprägt von Vergebung. Das ist tröstlich für Führungskräfte: >Vergebung ist der Kern der Beziehung einer Führungskraft zu Gott< (Wright 2003:276). Nicht die Moral macht aus einer Führungskraft eine christliche Führungskraft, sondern die Christusbeziehung.“ (:65) Das Wissen um Vergebung ist gerade in Bezug auf (schwierige) zu treffende Entscheidungen wichtig. „Verantwortung übernehmen und Vergebung erfahren, sind oft zwei Seiten der gleichen Medaille.“ (:66) Kessler plädiert für eine Fehlerkultur. In Bezug auf Vergebung kann es aber auch sein, dass man dem „Menschen“ vergibt und sich trotzdem vom „Mitarbeiter“ einer Organisation trennen muss, zum Schutz der Gemeinschaft. Als Fazit schreibt er: „Verantwortung und Vergebung sind miteinander verbunden: Verantwortung wird meist nur da übernommen, wo Vergebung möglich ist.“ (:75)
Abschließend in Kapitel 6, macht Kessler noch einmal Mut zum Führen. „Eine Organisation, eine Gesellschaft krankt, wenn nur die Falschen bereit sind zu führen.“ (:77). Wer aber das Wissen um Dienst, Macht, Verantwortung und Vergebung hat, der soll die Führung übernehmen. „Nimm den Führungsstab, dem man Dir reicht, in die Hand.“ (:77)
Kesslers Ausführungen sind sehr dicht und sehr wichtig. Gerade die kompakte Zusammenschau aller vier Bereiche macht dieses Buch über Führung so wertvoll. Für mich wird hier deutlich, dass Gefahr von Führungskräften immer dann ausgeht, wenn sie einseitig werden. Ebenso entsteht die Gefahr für die Geführten, wenn sie ihre Führungskräfte einseitig begrenzen. Mich persönlich haben die Kapitel über Dienst, über Macht und über Vergebung am meisten angesprochen.
Ich wünsche mir, dass viele führungsbegabte Christen dieses Buch lesen und sich verantwortlich in unsere Gesellschaft einbringen. Denn mit einer dienenden Führungseinstellung wird verantwortlich mit Macht umgegangen und dann ist auch Vergebung möglich. Das brauchen wir.

 Wie kann man eigentlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die ehrenamtliche Gemeindejugendarbeit gewinnen? Diese Frage beschäftigt viele Menschen, die ein Anliegen für den Bau des Reiches Gottes haben.
Wie kann man eigentlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die ehrenamtliche Gemeindejugendarbeit gewinnen? Diese Frage beschäftigt viele Menschen, die ein Anliegen für den Bau des Reiches Gottes haben. Mintzberg, Henry/Ahlstrand, Bruce/Lampel, Joseph, Strategy Safari – Eine Reise durch die Wildnis des strategischen Managements, Frankfurt/Wien: Redline Wirtschaft bei Ueberreuter, 5. Auflage 2004
Mintzberg, Henry/Ahlstrand, Bruce/Lampel, Joseph, Strategy Safari – Eine Reise durch die Wildnis des strategischen Managements, Frankfurt/Wien: Redline Wirtschaft bei Ueberreuter, 5. Auflage 2004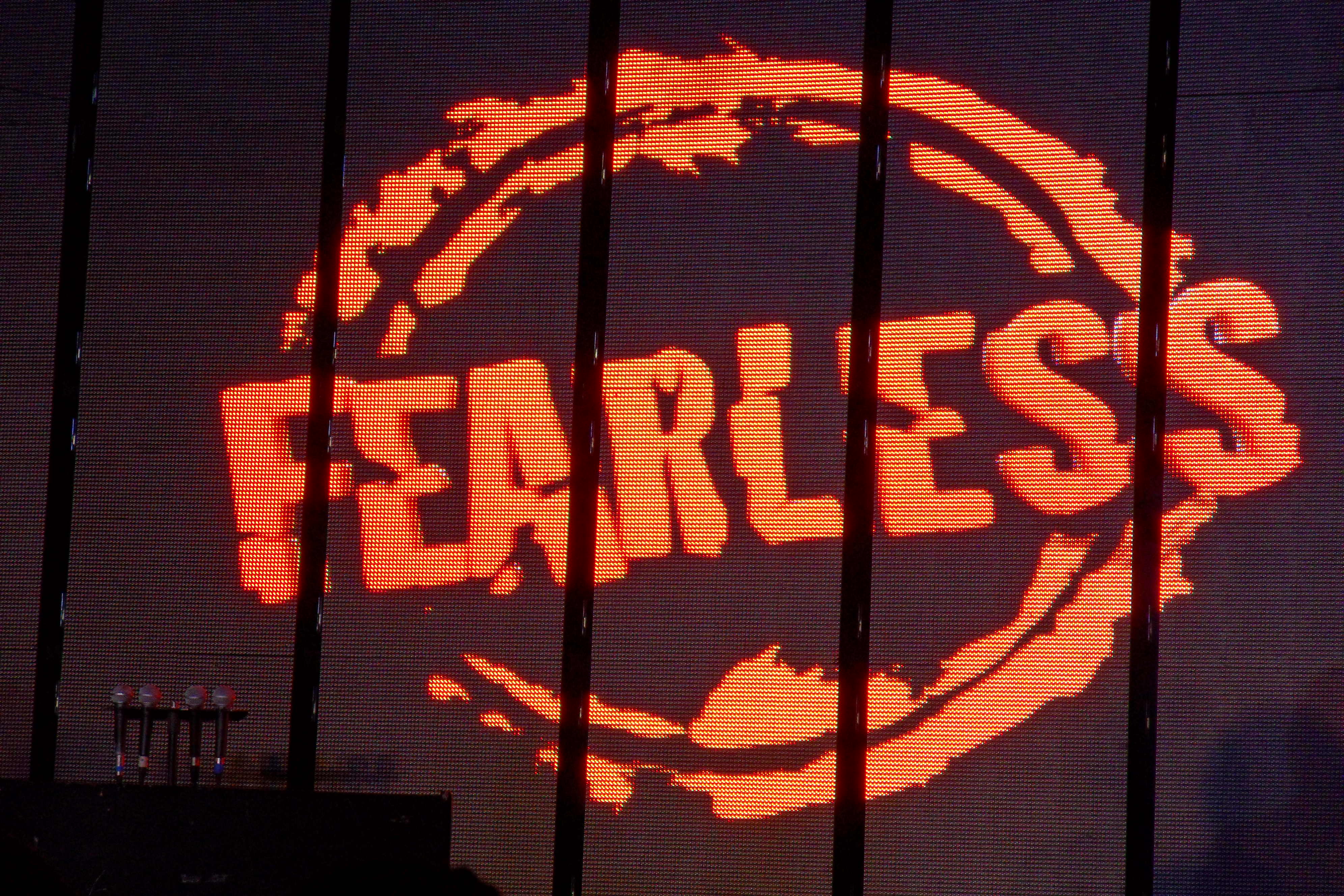 Für mich ist die Frage, inwieweit man die Dynamik nach Deutschland holen kann und ob sich eine deutsch-kenianische Partnerschaft sinnvoll aufbauen lässt. Die Entfernung ist weit. Ein Flug ist teuer. Die Kulturen sind verschieden. Kenia ist eine junge Generation, wo es wirtschaftlich dynamisch zugeht. Der Anteil evangelikaler Christen liegt bei fast 20 %. Deutschland stagniert und geht bevölkerungsmäßig zurück. Auch der christliche Glaube ist auf dem Rückzug. In einer deutschen Großstadt gibt es sicher mehr Parallelen als in einer deutschen Kleinstadt. Aber vielleicht brauchen wir wieder den Mut, Gott etwas in unserem Land zuzutrauen. Und da können uns die Afrikaner inspirieren. Unabhängig davon sind die Leitungsprinzipien der Kirche beachtenswert und dann übertragbar. Vorausgesetzt ist allerdings, dass sich eine Gruppe/Gemeinde in Deutschland diese Art von Leitung wünscht. Das kenianische Model ist sehr stark personenorientiert. Das ist uns in Deutschland in den Freikirchen eher fremd. Aber hier habe ich den Eindruck, dass es immer mehr junge Christen gibt, denen ein bis in die Spitzen ausgelebtes kongregationalistisches Modell nicht mehr behagt.
Für mich ist die Frage, inwieweit man die Dynamik nach Deutschland holen kann und ob sich eine deutsch-kenianische Partnerschaft sinnvoll aufbauen lässt. Die Entfernung ist weit. Ein Flug ist teuer. Die Kulturen sind verschieden. Kenia ist eine junge Generation, wo es wirtschaftlich dynamisch zugeht. Der Anteil evangelikaler Christen liegt bei fast 20 %. Deutschland stagniert und geht bevölkerungsmäßig zurück. Auch der christliche Glaube ist auf dem Rückzug. In einer deutschen Großstadt gibt es sicher mehr Parallelen als in einer deutschen Kleinstadt. Aber vielleicht brauchen wir wieder den Mut, Gott etwas in unserem Land zuzutrauen. Und da können uns die Afrikaner inspirieren. Unabhängig davon sind die Leitungsprinzipien der Kirche beachtenswert und dann übertragbar. Vorausgesetzt ist allerdings, dass sich eine Gruppe/Gemeinde in Deutschland diese Art von Leitung wünscht. Das kenianische Model ist sehr stark personenorientiert. Das ist uns in Deutschland in den Freikirchen eher fremd. Aber hier habe ich den Eindruck, dass es immer mehr junge Christen gibt, denen ein bis in die Spitzen ausgelebtes kongregationalistisches Modell nicht mehr behagt.